In diesem Artikel erfahren Sie, woher Marktdaten kommen, welche Typen es gibt und welche verschiedenen Themen rund um Marktdaten behandelt werden und wie Sie sie optimal nutzen können.
Infos
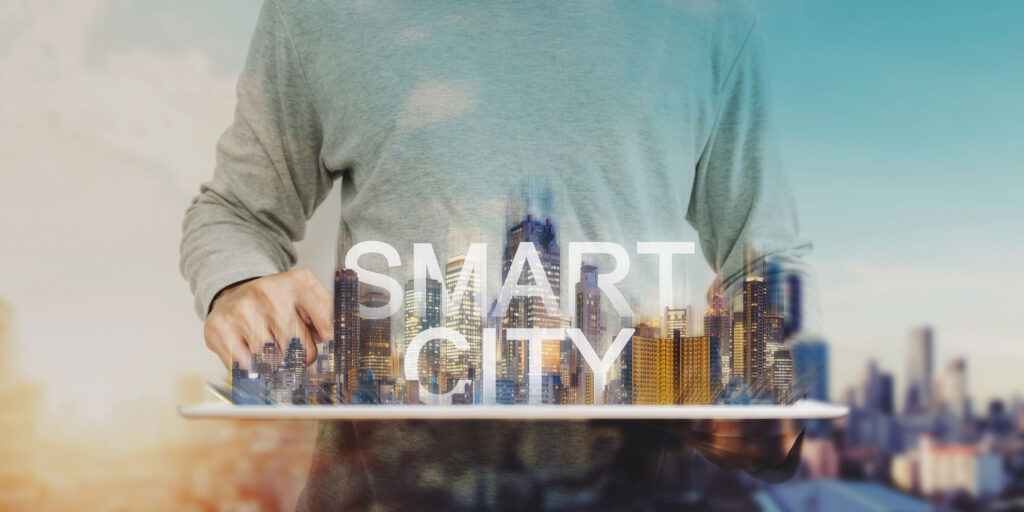
Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der die öffentlichen Verkehrsmittel so effizient und günstig sind, dass es sich kaum noch lohnt ein Auto zu fahren. Zudem ist die Ladeinfrastruktur mittlerweile so gut entwickelt, dass die wenigen Autos alle mit Elektroantrieb fahren können. Es gibt kaum noch Feinstaubemissionen durch den Verkehr und die Luftqualität ist viel besser geworden, auch die Lärmbelastung ist gesunken.
Wenn Sie einen Termin auf dem Amt brauchen oder einen Antrag ausfüllen müsent, können Sie das bequem auf dem Handy machen. Ist Ihre Stimme bei Bürgerentscheiden gefragt, können Sie auch an diesen ganz einfach online teilnehmen und zur Verbesserung Ihrer Stadt beitragen.
Das und noch viel mehr wäre durch Smart Citys möglich, denn durch die effiziente Vernetzung und Digitalisierung lassen sich viele Vorteile erzielen. All das wollen wir in diesem Beitrag erkunden.
Das Wort „smart“ ist vielen aus dem Englischen bereits als clever, schlau oder findig bekannt. Im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung bedeutet das Wort allerdings eher so viel wie, intelligente und vernetzte Technologie.
Mit Intelligenz ist dabei gemeint, dass die verschiedenen Bereiche in der Stadtverwaltung und Versorgung durch digitale Technik so miteinander vernetzt sind, dass sie kommunizieren können. Durch diese Art der Kommunikation kann eine höhere Effizienz erreicht werden als es bei herkömmlichen Verwaltungen der Fall ist, denn das passiert durch eine Datenübertragung in Echtzeit.
Eine „smarte Stadt“ (auch bekannt als „Smart City“) ist eine Stadt, die moderne Technologien wie das Internet der Ding (IoT) und intelligente Lösungen nutzt, um die Lebensqualität und Nachhaltigkeit für ihre Bewohner zu verbessern. Das Internet der Dinge steht für eine vernetzte Welt aus smarten Geräten, die miteinander kommunizieren können, es bildet die Basis für eine digitale und vernetzte Stadt.
Unsere Bevölkerung konzentriert sich mittlerweile immer mehr in Ballungszentren wie großen Kommunen und Großstädten. Deshalb ist es unverzichtbar, auf Vernetzung und Digitalisierung zu setzen um die Lebensbedingungen in den städtischen Gebieten zu verbessern.
In einer smarten Stadt werden digitale Strukturen, wie künstliche Intelligenz, zur Datenanalyse eingesetzt, um verschiedene Bereiche wie Verkehr, Energie, Umwelt, Sicherheit und Kommunikation effektiver zu gestalten. Ziel ist es, Ressourcen nachhaltiger zu nutzen, den Bürgern bessere Dienstleistungen anzubieten und die Sicherheit zu erhöhen.
Die Digitalisierung ist die Grundbasis für eine smarte Stadt, denn ohne digitale Grundlagen wie das Internet können die einzelnen Technologien nicht miteinander verknüpft werden. Nur im Zusammenspiel aller Bereiche ist ein maximaler Effekt zu erreichen.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Digitalisierung vor allem auch in Behörden und Stadtverwaltungen schneller voranschreitet, denn so können Entscheidungswege verkürzt werden.
In smarten Städten werden verschiedene Techniken eingesetzt, um Effizienz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu verbessern.
Diese Bereiche bilden das Rückgrat einer smarten Stadt und werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den Bedürfnissen und Herausforderungen einer modernen, vernetzten Gesellschaft gerecht zu werden.
Die Smart City soll zu allererst ihren Bewohnern dienen und ihnen das Leben angenehmer gestalten. In vielen Aspekten kann Digitalisierung helfen die Effizienz zu erhöhen und den Alltag zu vereinfachen.
Durch verbesserte Technologie kann die Sicherheit in öffentlichen Bereichen wie Stadtparks und den Straßen gesteigert werden. Videoüberwachung und IoT-fähige Sensoren können verdächtige Aktivitäten in Echtzeit an die Einsatzkräfte übertragen und so für eine schnelle Reaktion sorgen.
Durch digitale Überwachung und bessere Vernetzung können Städte besser planen und Ressourcen wie Energie, Wasser und Verkehr effizienter nutzen. Intelligente Messsysteme und Sensoren ermöglichen es, den Verbrauch zu überwachen und Maßnahmen zur Ressourceneinsparung zu ergreifen.
Digitale Lösungen werden dazu beitragen das Städte ihren Bürgern bessere Dienste anbieten können. Online-Plattformen ermöglichen einen einfacheren Zugang zu städtischen Dienstleistungen wie Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen.
Die Bürgerbeteiligung ermöglicht es den Einwohnern, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Die Sinus-Milieus® z.B. liefern einen wichtigen Beitrag dazu, Bedürfnisse und Lebensstile der Bevölkerung besser zu verstehen und auf diese einzugehen.
Smart Homes erzeugen große Mengen an Daten über Energieverbrauchsmuster, Nutzungsgewohnheiten und Lebensstil der Bewohner. Diese Daten können anonymisiert und aggregiert werden, um wertvolle Informationen für die städtische Planung bereitzustellen. Stadtverwaltungen können damit Verbrauchsmuster verstehen, Energiebedarf prognostizieren und städtische Dienstleistungen effektiver gestalten.
Sprechen Sie uns an.
Auf dem Stand von heute stehen wir in den meisten Städten gerade erst am Anfang der Entwicklung zur intelligenten Stadt. Denn das Vorhaben ist komplex und umfangreich. Doch mit vielen kleinen Schritten lässt sich dem Ziel näher kommen.
Hier finden Sie einige Ideen, wie das funktionieren kann.
Damit die Transformation zur Smart City klappt müssen viele Personen zusammenarbeiten, nur so kann das volle Potenzial genutzt werden. Wenn Bürger mit Umfragen, Konferenzen und Workshops in die Stadtentwicklung miteingebunden werden, können sich viele neue Perspektiven und Lösungsansätze ergeben. Denn oftmals haben die Planer nur wenig Ahnung von der tatsächlichen Realität und so kann ein Austausch auf Augenhöhe geschaffen werden von dem alle profitieren.
Der Smart City Index ist ein Bewertungsinstrument, das verwendet wird, um das Fortschreiten und die Reife von Städten in Bezug auf ihre „Smart City“-Initiativen zu messen. Es gibt verschiedene Versionen und Ansätze für den Smart City Index, aber im Allgemeinen basiert er auf der Erfassung und Bewertung einer Reihe von Parametern, die den Grad der Digitalisierung und intelligenten Technologien einer Stadt widerspiegeln.
Typischerweise umfassen diese Parameter Bereiche wie:
Der Smart City Index bewertet diese Parameter auf der Grundlage spezifischer Kriterien und Daten, die von den Städten erfasst werden. Die Ergebnisse werden dann analysiert und verwendet, um einen Gesamt-Smart-City-Score für jede Stadt zu generieren, der ihre Fortschrittlichkeit auf dem Weg zur Smart City darstellt.
Mit „Open Data“ ist in der Stadtentwicklung die Offenlegung aller kommunalen Daten auf einer öffentlich zugänglichen Plattform gemeint, natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes.
Das Ziel ist es das Potenzial der der Daten für die Stadtwaltung und die Bewohner der Stadt zu nutzen. Mit Hilfe dieser Daten können zukünftige Vorhaben besser und effektiver geplant werden, da beispielsweise der aktuelle Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln jederzeit einsehbar ist.
Außerdem geht es darum das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und sie in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden.
Die Einführung von Smart City-Konzepten im ländlichen Raum erfordert eine Anpassung an die speziellen Bedürfnisse dieser Gebiete. Denn im ländlichen Raum ist die Bevölkerungsdichte viel geringer und somit ist die Infrastruktur meist nicht auf demselben Stand wie in der Stadt.
Die weitgreifende Digitalisierung und Speicherung der gesammelten Daten kann auch Schattenseiten haben.
Autor: Sabine Ahlemeier
Managing Director, MB Micromarketing GmbH
Sprechen Sie uns an!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen